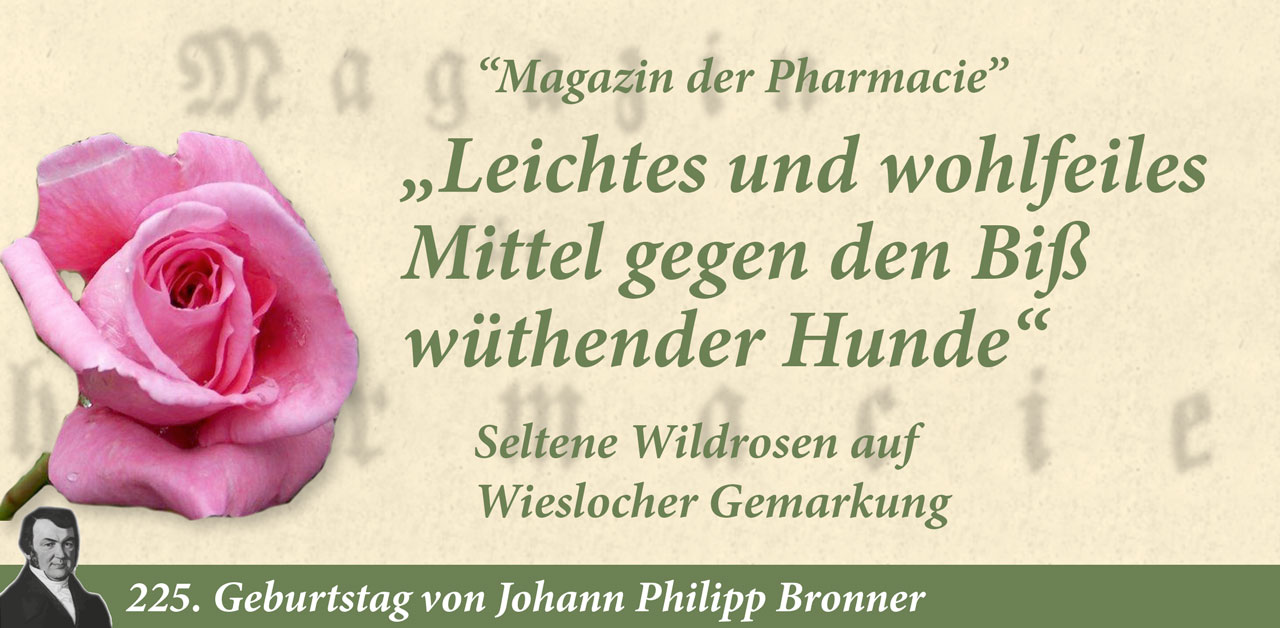In der Zeit des Biedermeier wurden Gemütlichkeit und Häuslichkeit großgeschrieben
In der Zeit des Biedermeier wurden Gemütlichkeit und Häuslichkeit großgeschrieben
„Jedem Bürger sein Brathuhn!“ ist ein Motto biedermeierlichen Speisens von 1814 bis 1848, also der Jahre, in denen Johann Philipp Bronner seinen Hausstand in Wiesloch gründete und weiter etablierte. „Biedermeier“ werden diese Jahre genannt, die mit der Zurückdrängung des mündigen, politisch denkenden Bürger einhergehen.
Nach der französischen Revolution, nach Herrschaft und Sieg Napoleons und ganz besonders nach dem Wiener Kongress (1814/15) kam es zu Unterdrückung der Freigeister, zur Restauration alter Herrschaftsverhältnisse und zur politischen Reaktion. Eine freie politische Meinungsäußerung der Bürger sollte durch Bespitzelungen und Zensur im Keim erstickt werden. Dies drängte die Bürger in ihre häusliche Atmosphäre und damit zu harmlosen Dingen zurück.
Gemütlichkeit und Häuslichkeit wurden großgeschrieben
Gemütlichkeit und Häuslichkeit wurden großgeschrieben. Man traf sich zum gemeinsamen Musizieren, zum Lesen von Büchern oder zum Imbiss. Die Speisezimmer waren behaglich möbliert und die meist kostbaren Esstische aus Eiben- oder Kirschholz mit schönen Intarsien erhielten zum Schutz erstmals ein farbiges Tischtuch. Die Tafelservice waren im Stil des Rokoko (verschnörkelt) oder des Empire (klassisch-geometrisch) und zeigten Streublümchen oder Banddekor. Die Hauptmahlzeit bestand aus einer Suppe, gekochtem Rindfleisch mit Sauce, Braten und Gemüse. Das Biedermeier ist die Erfindungszeit herrlicher Speisen, die heute noch geschätzt werden: Wiener Schnitzel, Gulasch, Geselchtes, Kraut und Knödel und vieles mehr.
Eine österreichische Gastwirtstochter beschrieb das als Zeitzeugin so: „…Kaffee war damals noch wenig gekannt, und es gab daher Morgensuppe […] Bei den Herrschaften waren Chocolad und Weinsuppe gebräuchlich […] Jeder Tag hatte im Bürgerhaus seine bestimmte Speise. Von der Suppe angefangen wiederholten sich die meisten Tage, jede Woche dasselbe, nur Sonntag und Donnerstag […] wechselten. Sonst waren Suppe, Fleisch und Gemüse und das warme Nachtmahl am selben Tag gleich.“ (Ingrid Haslinger. Augenschmaus und Tafelfreuden. Klosterneuburg, 2001. S. 64ff)
Bei den Bürgerfamilien zog der „service á la russe“ ein
Zwang in jeder Form war beim Speisen verpönt. Die Kinder wurden in der Küche „abgefüttert“, steife Zeremonien, wie beim Adel gebräuchlich, und alte Etikette ignorierte man. Während Wilhelm von Baden mit seiner großherzoglichen Familie im „schwedischen Speisezimmer“ zu Karlsruhe – auch Napoleon hatte hier gespeist und laut Aufzeichnungen des jungen Markgrafen gar keinen guten Eindruck bei Tisch hinterlassen – noch nach den „service á la francaise“ speiste, also alle Gerichte einer Mahlzeit/ einer Speisefolge kamen auf einmal auf den Tisch, was dazu führte, dass das eine oder andere Gericht schon vor dem Verzehr kalt geworden war, zog in den biedermeierlichen Bürgerfamilien das „service á la russe“ zwar zögerlich aber doch langsam ein.
Ein eher „leer“ wirkender Tisch wurde ersatzweise für die einst so überbordende, gleichzeitige Fülle der Schüsseln, Platten und Schalen mit einer Tischdekoration optisch aufgehübscht. Man griff zum Tafelaufsatz mit Konfekt, zur abendlichen Kerze oder zum Blumenarrangement. Einfaches galt es hübsch und appetitlich zu dekorieren: „ Beym Garnieren der Schüsseln hat man keine andere Absicht, als die einladende Appetitlichkeit eine Speise zu erhöhen; wir folgen darin dem Maler […] Selbst mit Petersilie, geriebener Semmel, Schnittlauch usw. bestreuen wir die Schüsseln und Speisen nur deßwegen, damit unsere Speisen ein desto schöneres Aussehen erhalten.“
Bronner’sche Gartenhaus als biedermeierliches Speisezimmer
Am „Tag des offenen Denkmals 2017“ präsentierte sich das Bronner’sche Gartenhaus als biedermeierliches Speisezimmer und wurde so zum absoluten Publikumsrenner. Angelehnt an ein Kochbuch, das der Bronner-Zeitgenosse Carl Spitzweg für seine Nichte geschrieben hatte, griffen wir in die „fiktive Mottenkiste“ und zauberten „Dem Herrn Apotheker seine Leib-Speisen“ auf den Tisch: Als Vorspeise eine Kräuter-Soup, als Hauptgang einen gespickten Rehrucken mit allerlei Wurzelgemüs und Knödln. Als Dessert schließlich Caffe und allerley Delicioses. Den Besucher, dem das noch zu wenig war, verwöhnten wir mit einer Haus-Führung über biedermeierliche Speisekultur.
Oder war alles ganz anders zuhause bei den Bronners? Alles würziger und viel deftiger?
Hören wir doch einmal kurz hinein: Es klopfte leise an der Türe und die Magd trat herein. „Es steht im Nebenzimmer ein Imbiss bereit, Wein und Brot und etwas Käse.“ … “Wenn die Herren mir folgen wollen“, sagte Bronner und ging voraus in das ebenfalls matt erleuchtete Nebenzimmer. Dessen Einrichtung war einfach, aber geschmackvoll und gediegen Auf dem runden Tisch, auf welchem die Lampe stand, waren irdene Teller, Gläser, Brot und Beilagen aufgetragen. Der Apotheker rückte den Herren die Stühle zurecht, nahm die Weinflasche in die Hand und besah das Etikett…“ (Karin Hirn. Der Garten des Apothekers. Karlsruhe, 2011.S. 92 ff).
Oder sogar so, wie damals im großherzoglich Karlsruher Schloss?
„In diesem Moment war ein leises Händeklatschen zu hören, die Flügeltüren zum Speisezimmer waren lautlos geöffnet worden und gaben den Blick auf eine reich gedeckte Tafel frei […].Ein Lakai brachte den Apotheker an den für ihn bestimmten Platz an der Tafel und bediente ihn mit Speisen und Wein. […] Schräg gegenüber, aber doch etwas weiter entfernt, konnte der Apotheker das Markgrafenpaar an der Tafel beobachten. Dort drüben war man in lebhaftem Gespräch, an dem sich auch die Prinzessin Sophie beteiligte. Der Apotheker beobachtete, wie die Diamanten an ihrem weißen Hals blitzten, er sah die weichen und eleganten Rundungen von Hals und bloßen Schultern, er sah ihre lebhaften Augen und er bewunderte im Stillen und ganz unbemerkt ihr Lächeln und ihre Sicherheit, mit der sie sich an der Konversation beteiligte.“ (S. 74)
Wer weiß es heute in unserer modernen Zeit und wer kann schlußendlich in die wahren Begebenheiten hineinschauen?